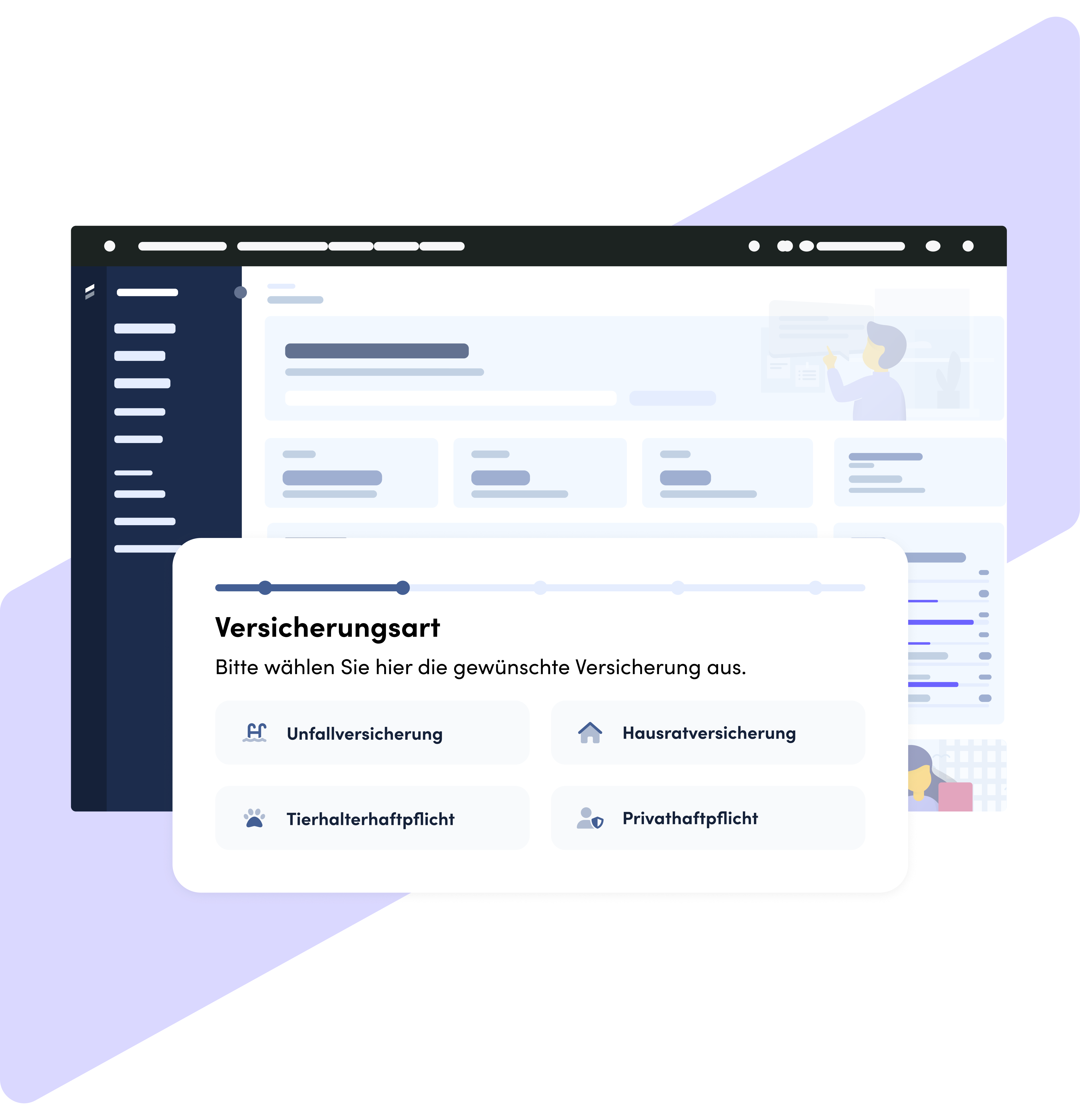Die Entscheidung zwischen Build (Eigenentwicklung) und Buy (Fremdsoftware, z.B. as SaaS-Angebot zu mieten) ist ein zentraler strategischer Schritt in der Softwareentwicklung.
Disclaimer
Auch bei einer Eigenentwicklung (Build) können Abhängigkeiten entstehen – etwa durch die Zusammenarbeit mit externen Entwicklungspartnern, fehlendes internes Know-how oder proprietäre Frameworks. Eine eigene Lösung ist nicht automatisch gleichbedeutend mit vollständiger technologischer Unabhängigkeit. Dennoch bietet Build grundsätzlich ein höheres Maß an Individualisierbarkeit, technischer Kontrolle und strategischer Flexibilität: Architektur, Schnittstellen, Sicherheitsmodelle und der künftige Ausbau können gezielt auf die eigenen Anforderungen abgestimmt werden. Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur: „Bauen oder kaufen?“, sondern auch: „Wer beherrscht langfristig die technologische Grundlage unseres Geschäfts – und in welchem Maß?“ Selbst bei externer Entwicklung besteht – im Gegensatz zu vielen Standardlösungen – weiterhin die Möglichkeit, die technologische Hoheit abzusichern. Durch vertragliche Regelungen, umfassende Dokumentation oder Software-Escrow-Modelle kann sichergestellt werden, dass die Lösung auch unabhängig vom ursprünglichen Partner weitergeführt oder an andere Dienstleister übergeben werden kann (vgl. Bewertungsmatrix „Business Continuity“).
Die folgende Bewertungsmatrix hilft dabei, technische, organisatorische und strategische Faktoren systematisch gegenüberzustellen und eine fundierte Entscheidung im Unternehmenskontext zu treffen.
1. Strategische Relevanz & Differenzierung
Welche strategische Rolle spielt die Software im Geschäftsmodell? Handelt es sich um einen echten Differenzierungsfaktor mit Einfluss auf den Markterfolg – oder um eine unterstützende Funktion, bei der etablierte Standards ausreichend sind?
| Erläuterung | Build | Buy | |
|---|---|---|---|
| Anpassbarkeit & Strategie | Change Management: Wie ist die Bereitschaft Prozesse an Standardsoftware anzupassen – oder besteht der Wunsch, bestehende Prozesse möglichst exakt digital abzubilden? | Hohe Anpassbarkeit: Ideal, wenn kundenspezifische Prozesse erhalten oder optimiert werden sollen. Besonders geeignet, wenn Software zur Differenzierung beiträgt oder Change-Management für Standardprozesse vermieden werden soll. | Geringe Anpassbarkeit: Buy setzt voraus, dass das Unternehmen bereit ist, Prozesse an die Software anzupassen („Best Practice“-Vorgaben). Je nach Volumen für den Software-Anbieter besteht mehr Gestaltungsspielraum. |
| Differenzierung | Leistet die Software einen Beitrag zur Differenzierung am Markt, z. B. durch besondere Funktionen, Customer Experience, Geschwindigkeit oder Integrationsfähigkeit? | Hohe Wirkung bei maßgeschneiderten Lösungen, wenn durch Individualisierung ein echter Marktvorteil entsteht (z. B. UX, Geschwindigkeit, Exklusivität). | Geringe Differenzierung – Standardlösungen bieten selten einzigartige Vorteile. Geeignet bei rein unterstützenden oder intern standardisierten Use Cases. |
2. Technologische Kontrolle & Entwicklungshoheit
Wie wichtig ist es, die Kontrolle über Technologie, Architektur, Sicherheit und Weiterentwicklung zu behalten? Relevant, wenn z. B. regulatorische, sicherheitsrelevante oder integrationskritische Anforderungen bestehen.
| Erläuterung | Build | Buy | |
|---|---|---|---|
| Technologiekontrolle | Wie viel Einfluss besteht auf Architektur, Technologie-Stack, Entwicklungsrichtlinien und Sicherheitsmechanismen? | Volle Kontrolle über Technologie, Architektur, Entwicklungsprozess und Security-Design. Ideal bei starker IT-Strategie oder branchenspezifischen Anforderungen. | Eingeschränkt – Technologie, Sicherheit und Release-Strategie (und Zyklen) sind vorgegeben. Bei Cloud/SaaS oft keine tiefe Anpassbarkeit an eigene IT-Strategie möglich. |
| Vendor Lock-in | Risiko der Abhängigkeit durch proprietäre APIs, Formate, Prozesse. | Gering – Kontrolle über Code, APIs, Datenformate etc. ermöglicht langfristige Flexibilität. | Lock-in durch Formate, Schnittstellen oder fehlende Exportmöglichkeiten. Ggf. auf ein Software-Escrow achten. |
| Transparenz & Debugging | Wie gut lässt sich die Lösung im Fehlerfall analysieren und überwachen? Zugriff auf Logs, Traces, Monitoring, Code? | Voller Zugriff auf alle Komponenten – von Logfiles über Code-Ebene bis Monitoring. Erleichtert schnelle Fehleranalyse, besonders bei komplexer Systemumgebung. | Eingeschränkt – i.d.R. nur den Support. Eigenanalyse ist oft nicht möglich, da Logs und Fehlerursachen oft nicht zugänglich sind. Wichtig, auf entsprechends SLAs achten. |
3. Technische Fähigkeiten & Ressourcenverfügbarkeit
Bestehen im Unternehmen (oder im Partnernetzwerk) die nötigen Kapazitäten, Kompetenzen und Prozesse, um eine Software eigenständig entwickeln, betreiben und langfristig pflegen zu können?
Diese Kategorie ist besonders relevant, wenn es um Machbarkeit, Geschwindigkeit und Betriebssicherheit geht.
| Erläuterung | Build | Buy | |
|---|---|---|---|
| Ressourcenverfügbarkeit | Bestehen intern oder extern (über Dienstleister) die nötigen Entwickler-Ressourcen? | Build ist möglich, wenn entweder interne Teams vorhanden sind oder ein externer Partner beauftragt werden kann. Initialaufwand und Steuerung notwendig. | Schneller verfügbar, geringerer Initialaufwand. Ressourcenbedarf reduziert sich auf Auswahl, Konfiguration und Betrieb. |
| Wartung & Updates | Wer ist für Weiterentwicklung, Bugfixes, Security verantwortlich? | Intern. Hohe Flexibilität, aber auch volle Verantwortung. | Extern. Wartung & Features durch Anbieter – ggf. nicht bedarfsgerecht. |
4. Sicherheit, Compliance & Business Continuity
Welche Anforderungen bestehen an Datenschutz, IT-Sicherheit, regulatorische Vorgaben und die langfristige Verfügbarkeit der Lösung – insbesondere bei geschäftskritischen Anwendungen?
| Erläuterung | Build | Buy | |
|---|---|---|---|
| Sicherheit & Datenschutz | Wie sensibel sind die Daten, und wie hoch sind die Anforderungen an Zugriffsschutz, Verschlüsselung, Netzwerksicherheit, Datenhaltung, Compliance-Audits? | Volle Kontrolle über Sicherheitsarchitektur und Datenhaltung. Erlaubt maßgeschneiderte Schutzmaßnahmen. | Shared Responsibility – Anbieter muss geprüft & ggf. zertifiziert sein (z.B. SOC, ISO). |
| Regulatorik & Compliance | Gibt es branchenspezifische Vorgaben oder interne Richtlinien, die erfüllt werden müssen (z. B. DSGVO, BAIT, ISO, Auditability)? | Compliance kann gezielt eingebaut werden – insbesondere bei komplexen, branchenspezifischen Anforderungen (z. B. Health, Finance). | Anbieter müssen passende Zertifizierungen vorweisen. Gute Wahl bei Standardvorgaben, weniger flexibel bei Sonderregeln. |
| Business Continuity & Ausfallsicherheit | Wie lässt sich sicherstellen, dass die Lösung langfristig verfügbar bleibt – auch bei Problemen mit dem Anbieter? Welche Rolle spielen Wartung, Fehlerbehebung, Exit-Szenarien? | Kontrolle über Code und Deployment ermöglicht Failover-Strategien und langfristige Sicherstellung (z. B. durch Escrow). Guter Schutz vor externen Risiken. | Abhängig von Anbieter-Verfügbarkeit. Bei kleineren SaaS-Anbietern oft keine Escrow-Option. Risiken bei Insolvenz, API-Änderungen oder Wegfall des Produkts. |
5. Integration & Skalierbarkeit
Wie gut lässt sich die Software in bestehende Systeme und Prozesse integrieren – und wie flexibel ist sie in Bezug auf zukünftige Anforderungen und Wachstum?
| Erläuterung | Build | Buy | |
|---|---|---|---|
| Systemintegration & APIs | Wie gut kann die Lösung mit bestehenden Systemen kommunizieren? Welche Schnittstellen stehen zur Verfügung? Gibt es individuelle Prozesse, die angebunden werden müssen? | Nahtlose Integration möglich, da Schnittstellen frei definierbar sind. Ideal bei heterogenen IT-Landschaften oder komplexen Prozessen. | Oft nur vordefinierte Schnittstellen. Gute Unterstützung für Standardtools, aber eingeschränkt bei Legacy- oder Spezialsystemen. |
| Skalierbarkeit | Wie gut lässt sich die Lösung an steigende Anforderungen (z.B. Benutzerzahlen, Datenmengen, neue Standorte oder neue Funktionen, Mandantenfähigkeit) anpassen? | Architektur kann gezielt auf Skalierbarkeit ausgelegt werden – horizontal, modular oder mandantenfähig. Langfristige Flexibilität bei Wachstum oder Expansion. | Eingeschränkt – Skalierbarkeit hängt vom Anbieter und Lizenzmodell ab. Technische Limitierungen möglich. |
6. Kosten & Geschwindigkeit
Wie wichtig sind schnelle Verfügbarkeit und niedrige Anfangskosten – im Vergleich zu langfristiger Wirtschaftlichkeit, Kontrolle und Investitionssicherheit?
| Erläuterung | Build | Buy | |
|---|---|---|---|
| Initiale Kosten | Welche Kosten fallen für Konzeption, Implementierung, Lizenzierung und Rollout an? | Höher – durch Planung, Entwicklung, Testing etc. Budgetbedarf lässt sich aber gezielt steuern (z. B. MVP-Phasen, modulare Entwicklung). | Gering – Lizenzen oder Subscriptions lassen sich sofort nutzen. Einstiegskosten sind kalkulierbar. Ggf. höhere Kosten bei Customizing oder Onboarding. |
| Time-to-Market | Wie schnell kann eine funktionierende Lösung bereitgestellt werden? | Länger – abhängig von Projektumfang, Entscheidungsfreude und Verfügbarkeit von Ressourcen (intern oder extern). | Sehr schnell – besonders bei SaaS oder konfigurierbarer Software. Oft direkt einsatzbereit. Wenn Integrationsbedarf besteht, aber auch hier länger. |
| Langfristige Kostenstruktur | Wie entwickeln sich die Kosten über die Zeit – inkl. Lizenzen, Wartung, Erweiterungen und technologischem Wandel? | Volle Kontrolle über Wartung und Weiterentwicklung. Kein Vendor Lock-in. Investitionen amortisieren sich bei langfristiger Nutzung oder Wiederverwendbarkeit. | Laufende Lizenz- und Betriebskosten. Ggf. zusätzliche Kosten bei Wachstum (Nutzerzahlen, Module) oder Anbieterwechsel. |
Fazit: Wie geht es nun weiter?
Jede Kategorie bewerten: z. B. mit 1–5 Punkten je nach Relevanz und Eignung.
Prioritäten setzen: Was ist besonders wichtig (z. B. Sicherheit vs. Time-to-Market)?
Build + Buy vergleichen: Gesamtbewertung ergibt ein gutes Stimmungsbild – oft ergänzt durch strategische „K.O.-Kriterien“ bei der Analyse und Definition des gewünschten Funktionsumfangs.
Gerne unterstützen wir bei Auswahlgesprächen mit Softwareanbietern im Rahmen der Festlegung der Gesamtstrategie und helfen beim Abgleich mit einem Konzept für die Eigenentwicklung.